Michael Hagner : Foucaults Pendel und wir.
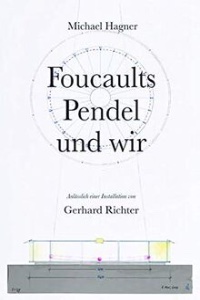
«Und sie dreht sich doch!» Seit dieses Murmeln Galileo Galilei zugeschrieben wurde, wissen wir, dass wir nicht das Zentrum aller Dinge sind und dass die Erde sich um die Sonne und um ihre eigene Achse dreht. Aber haben wir auch eine Anschauung davon?
Isaac Newton vereinigte damals in seiner mathematischen Naturlehre das Modell eines heliozentrischen Weltbildes von Nikolaus Kopernikus mit Galileis Hypothesen zur Physik der Bewegung und Johannes Keplers „Gesetz“, die Planeten bewegten sich aufgrund der Anziehung durch die Sonne auf elliptischen Bahnen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse können eine Weltsensation darstellen, ohne gleich ein neues Weltbild zu installieren. Als der Pariser Physiker Léon Foucault 1851 die Erdrotation mit einem Pendel nachweisen konnte, musste niemand mehr von der Richtigkeit des Heliozentrismus überzeugt werden. Dennoch gilt das Experiment bis heute als eines der berühmtesten in der Geschichte der Wissenschaften. Hat also Foucaults Pendel immer noch mit uns zu tun?
In seinem neuen, mit vielen bislang unbekannten Bildern versehenen Buch geht Michael Hagner dieser brisanten Frage nach und zeigt, wie eng der Pendelversuch mit technischen Präzisionsbasteleien, ideologischen Konflikten, dem Aufstieg der Populärkultur sowie der Verbreitung von Bildmedien verbunden ist. Dabei behandelt Hagner kosmologische Fragen ebenso wie politische und ästhetische Vorstellungen über die öffentliche Inszenierung von Wissenschaft. Der Glaube an den zivilisatorischen Fortschritt durch die Wissenschaften prägte die öffentliche Geschichte des Pendels, bis Umberto Eco es in einem postmodernen Welttheater wiederverzauberte. Damit wurde die Bühne frei für die Vermutung, bei Foucaults Pendel könnte es sich auch um ein Kunstwerk handeln. In einer überraschenden Wende deutet Hagner die Installation Zwei graue Doppelspiegel für ein Pendel, die Gerhard Richter 2018 in der Dominikanerkirche in Münster eingerichtet hat, als Vorschlag, künstlerische und wissenschaftliche Reflektion auf paradoxe Weise miteinander in Korrespondenz treten zu lassen.
Nach wie vor sprechen wir geozentrisch von Sonnenauf- und -untergang. Als Ludwig Wittgenstein einmal fragte, weshalb das so ist, bekam er zur Antwort: „Vermutlich, weil es so aussieht, als würde sich die Sonne um die Erde bewegen.“ Seine Erwiderung: „Nun, wie hätte es denn ausgesehen, wenn es so ausgesehen hätte, als würde sich die Erde um ihre Achse drehen?“
Das detailreiche und glänzend geschriebene Buch des Zürcher Wissenschaftshistorikers Michael Hagner zitiert Wittgenstein nicht, aber es handelt von der Antwort auf seine Frage. Die Antwort lautete für ein Zeitalter vor der Raumfahrt: Wir können die Eigenbewegung der Erde nicht am Himmel ablesen, sondern nur in einem Experiment. 1851 hat es der französische Instrumentenbauer Léon Foucault vorgestellt, indem er die Rotation der Erde durch ein Pendel sichtbar machte. Dieses – ein langes Drahtseil und ein daran befestigtes, meist kugelförmiges Gewicht – schwingt zunächst genau auf die unbewegten Betrachter zu, die nach einiger Zeit merken, dass die Kugel sich im Uhrzeigersinn langsam von ihnen wegbewegt. Das Pendel schwingt seine Bahn, die Betrachter bewegen sich mit der Erde. Wer das lange aushält, kommt in Paris oder München in den Genuss eines Pendels, das nach 32 Stunden wieder genau auf die Beobachter zu schwingt. Am Nordpol geht es schneller.
Wir können dieses ausgezeichnete Buch von Michael Hagner nur jedem ans Herz legen.
Michael Hagner: „Foucaults Pendel und wir“. Anlässlich einer Installation von Gerhard Richter. Buchhandlung Walther König, Köln 2021. 396 S., Abb., geb., 38,– €