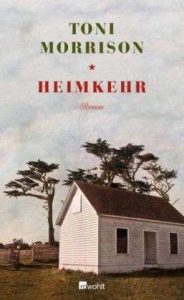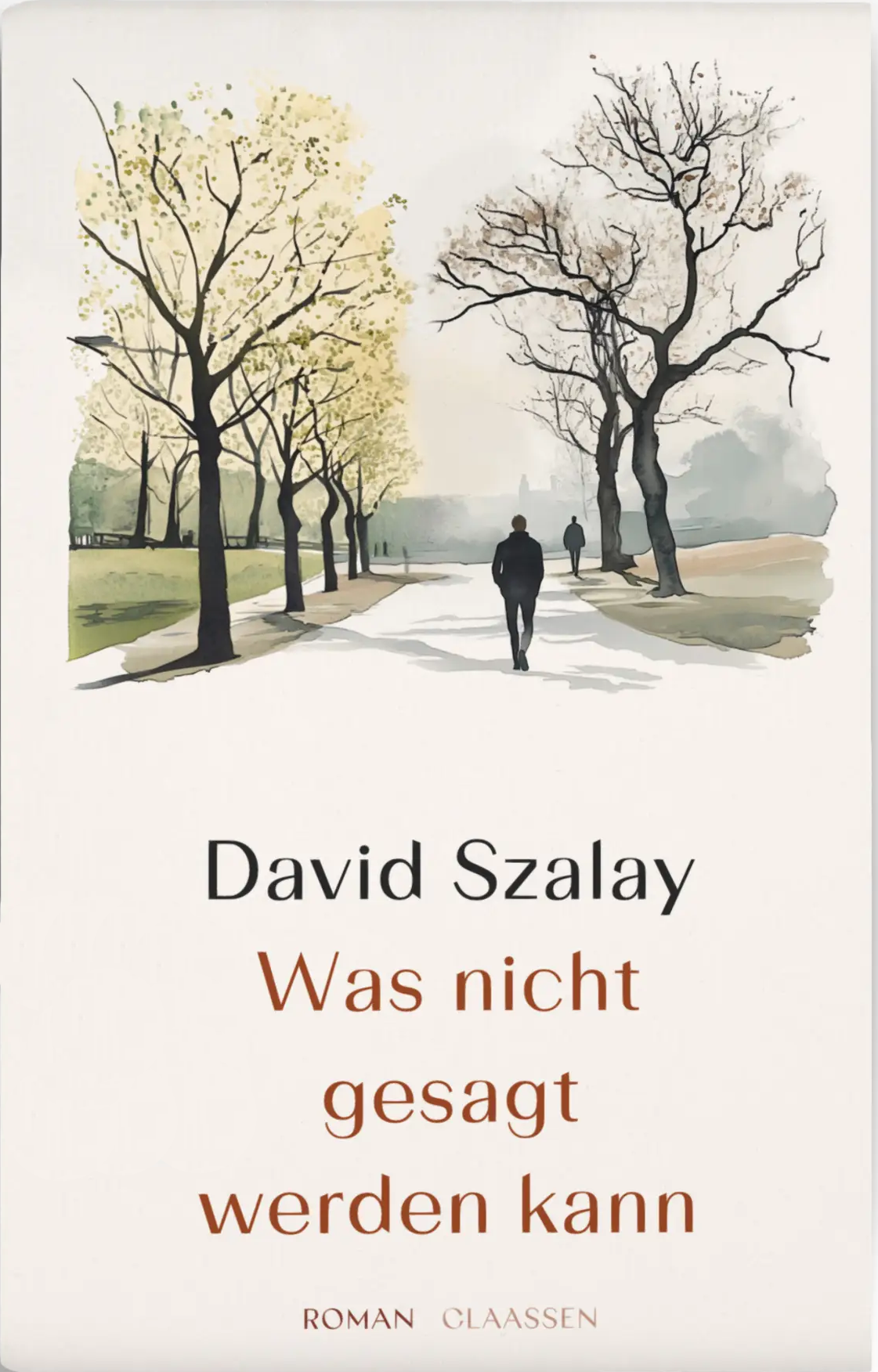
Man kann sich dem Sog dieses Romans (Originaltitel «Flesh»), der seinen Leser durch den Fleischwolf dreht, um ihn ebenso ratlos wie zermürbt, einsam und berauscht zurückzulassen, kaum entziehen. In Was nicht gesagt werden kann (welch glücklich gewählter Titel!) arbeitet sich David Szalay an der betäubenden Fremdheit des Lebens regelrecht ab.
Der Roman erzählt das Leben von István, den wir als einsamen sprachlosen Teenager kennenlernen und bis ins desillusionierte Mannesalter begleiten. In den dazwischenliegenden Jahren wird István wie Treibgut von zufälligen Begegnungen, den Strömungen des Lebens mit- und fortgerissen; eine Affäre mit einer älteren Nachbarin, die tragisch endet, nach der Verbüßung einer Haftstrafe sein Militäreinsatz im Irak, die Migration von Ungarn nach London, sein schwindelerregender Aufstieg in die britische Upperclass und schließlich seine resignierte Rückkehr in die Plattenbausiedlung Budapests, in der er aufgewachsen ist.
Entscheidend ist, was der Autor konsequent weglässt: dass es in Istváns Entwicklung genau nichts von einem agierenden, suchenden Helden gibt. Szalay skizziert einen Mann ohne Innenleben, der von willkürlichen Optionen hin- und hergerissen wird, der nichts steuern kann, seien es erotische oder materielle Wünsche derjenigen, die ihn umgeben oder die Wellenbewegungen einer globalisierten Wirtschaft. Ein durchweg phlegmatischer und passiver Teilnehmer an den Ereignissen seines Lebens und den Ereignissen der weiteren Welt, hat István etwas vom existenziellen Fremden an sich, der sich mit Camus’ Meursault oder Travis Bickle messen lassen kann.
Im Laufe des Romans werden die Natur und die Implikationen von Istváns Anpassungsfähigkeit allmählich enthüllt. Er beginnt mit einer distanzierten, aber neugierigen Naivität, unsicher, welche Freuden das Leben ihm bescheren könnte, aber bereit, stillschweigend einen Fuß vor den anderen zu setzen, bis er es herausfindet. Aber mit der Zeit verhärtet sich diese phlegmatische Akzeptanz in gespenstische Resignation. Bald scheint István völlig von seinen eigenen Wünschen entfremdet zu sein, ein Geist, der an den Rändern eines Lebens spukt, von dem er nicht einmal sicher ist, dass es sein eigenes Leben ist. Szalays Roman deutet etwas viel Beunruhigenderes an: die schleichende Erkenntnis, dass István vielleicht nicht in einem Akt des psychospirituellen Rückzugs verharrt, sondern auf klare und vernünftige Weise mit der Realität der kalten Gleichgültigkeit des Schicksals rechnet.
Das Gefühl der sozialen und emotionalen Entfremdung, das den Roman durchdringt, hat jedoch ein bemerkenswertes Gegengewicht. Szalay lässt den Leser nicht vergessen, dass István trotz seiner überweltlichen Abwesenheit in einem Körper existiert: Auch wenn er seine Wünsche nicht aussprechen kann, existieren sie dennoch. Ob es sein entstellender Drang nach Gewalt ist oder sein desorientierter und gelegentlich erhebender Drang nach sexueller Entlastung – es sind diese Taten, oft unvermittelt, durch die Szalay andeutet, was unter diesem Schweigen liegen könnte. Es ist aufschlussreich, dass István während der Zeit seines Lebens, die er im Krieg verbringt, am energischsten, ja handlungsfähig zu sein scheint. Während seine Erfahrung letztendlich durch ein Trauma auf dem Schlachtfeld und die monumentale Sinnlosigkeit des „Kriegs gegen den Terror“ geprägt sind, erfahren wir, dass es für István die Nähe und Unmittelbarkeit des Todes, eine unbestreitbare Konfrontation mit seiner Sterblichkeit, braucht, um sich zu spüren.
Szalay, gewiss ein Meister der Auslassung, der sparsamen Sätze, treibt die Reduktion in diesem Roman auf die Spitze. Über 380 Seiten hinweg ergibt sich der kumulative Effekt eines kontrollierten, fast skelletierten Minimalismus, eine Reihe von Daumenskizzen, die genau die benötigte Affektsumme andeuten. Die Dialoge sind durchweg redundante, staccatoartige Austausche von «Okays», «Wenn Du meinst», die nur selten in Ausrufe ausbrechen. Als man István fragt, wie es sich anfühlte, in der Armee zu sein, Menschen sterben zu sehen und eine Waffe zu schießen, antwortet er nach langem Zögern mit „es war okay“. Diese stilistische Flachheit wird mit einer Intensität eingesetzt, die die Idee einer bedeutungsvollen emotionalen Verbindung ins Absurde verzerrt.
Mit seiner Stille, den Verkrampfungen, Frustrationen und seinen Codes wird man versucht sein, diesen Text als einen Roman über Männlichkeit oder männliche Sexualität einzuordnen. Obwohl das mit Sicherheit nicht falsch ist, reißt Szalay jedoch eine weitaus spannendere metaphysische Dimension auf: die Frage nach den Dingen, die unaussprechlich sind, die Frage nach Unsagbarkeiten, die im Zentrum jedes Lebens stehen, Dinge, die außerhalb jeder sprachlichen Reichweite schweben und uns gleichwohl steuern.
David Szalay: Was nicht gesagt werden kann.
Claassen Verlag 2025
380 Seiten, 25,00 EUR